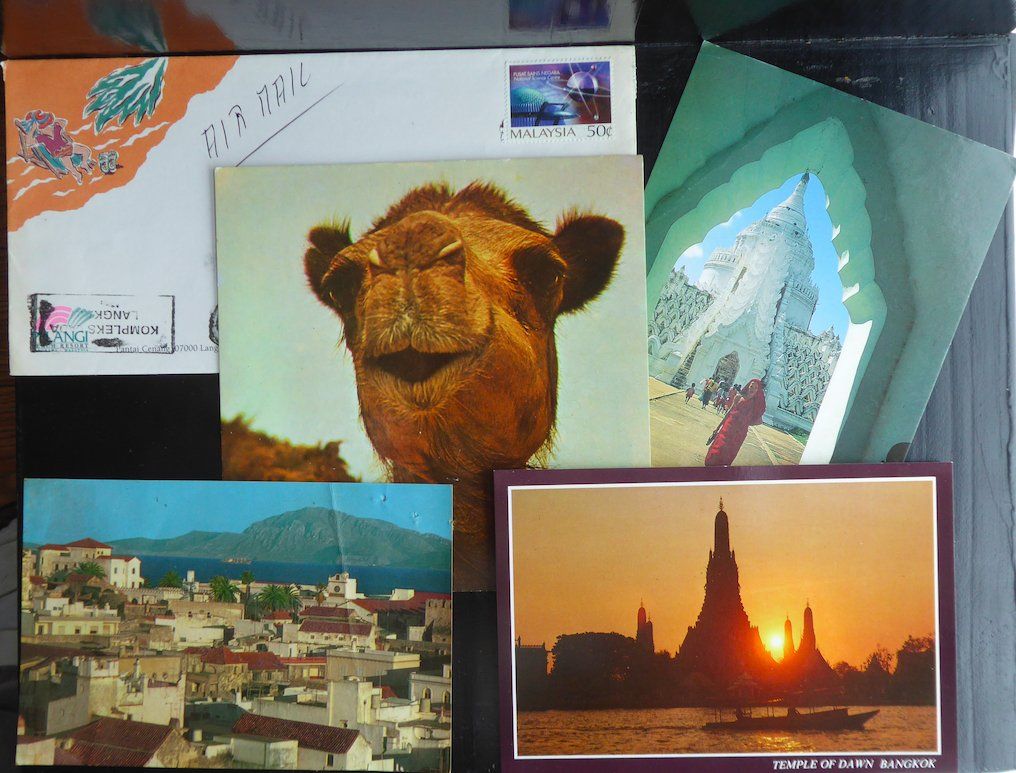Helgoland, ein Fels in der Brandung der Zeit.
Helgoland ist die einzige Hochsee-Insel Deutschlands, ein angenagter Buntsandstein-Felsen im Nordsee-Meer, ein geschäftstüchtiges Duty free Paradies, ein beliebtes Tagesausflugsziel für jederfrau und jedermann, gut begehbare Natur, eine spannende Geschichtsstunde, die Kinderstube von Kegelrobben, Lummen und Basstölpel und ein Ort in zwei Hälften: Unterland und Oberland. Na, ja – eher drei Hälften. Nach dem Krieg kam Mittelland dazu. Das Ergebnis menschlicher Zerstörung.
Diese Aufzählung lässt sich allerdings auch verkürzen: Helgoland ist auf den ersten Blick ein zollfreies Einkaufszentrum im Inselformat, auf den zweiten ein bequemer Spaziergang mit frischer Luft und weiter Sicht und bis zum dritten Blick kommt man nicht. Denn da ist man längst schon wieder auf dem Schiff.
Die deutsche ein-paar-Stunden-Insel.
Eigentlich präsentieren sich ja alle deutschen Inseln mit abwechslungsreicher Ferienvielfalt. Nur die entfernteste Insel gilt mehr als Ausflugs- denn als Urlaubsziel. Und das hat Folgen: Die meisten Besucher sind Tagestouristen, fokussiert auf schnelle Zollfrei-Schnäppchen und auf Kaffee mit Kuchen. Manche drehen noch eine Runde auf dem 3 Kilometer langen Klippenweg über das Felsmassiv: rasch zu den Vögeln und zur „Langen Anna“, dem Wahrzeichen der Insel.
Neugier und Wissensdurst bleiben so begrenzt wie der Aufenthalt. Aber was soll’s. Man hat genug gesehen und kann sagen: „Auch ich war auf Helgoland!“ Sehnsucht nach einem längeren Aufenthalt wird bei vielen Weltgereisten nicht geweckt. Denn die völlig aus der Zeit gefallene Eigenart der Insel wirkt eher befremdlich denn verführerisch.
Ein Reisebericht aus dem 19. Jahrhundert hat diese Eigenart der Insel so beschrieben: „Die Eintönigkeit hat etwas Verlockendes und Süßes. Alles wiederholt sich.“ Das stimmt im Grunde immer noch. Doch über die Gezeiten der Geschichte hinweg hat sich die Tonart des immer wieder Gleichen selbstverständlich verändert.
Ein gewolltes Einerlei.
Die heutige Tonart zeigt sich bei der Architektur in (immerhin) 14 Farben. Festgelegt beim „Neubau-Projekt Helgoland" Anfang der 50er Jahre. Ebenfalls Absicht: Das, was wir mittlerweile als monoton empfinden. Es hat sich auf Helgoland als „Ideal der Moderne“ verewigt: uniforme Häuser, Wohn- und Geschäftssträßchen streng getrennt.
Die Formensprache kommt so klar, knapp und geradlinig daher, dass sie vom charmant Lebendigen und idyllisch Heimeligen so weit entfernt ist wie die Distanz der Erde zum Mond. Und da Menschen nicht nur die Architektur, sondern auch die Architektur die Menschen beeinflussen, könnte es sein, dass dieses vom Bauhaus inspirierte Gesamt-Unkunstwerk, das schon sehr an den sozialen Wohnungsbau der Nachkriegszeit erinnert, auch das ganze Inselleben geprägt hat. Denn auch das wirkt streng gegliedert, regelhaft, distanziert und ungeschmeidig. Praktisch. Pragmatisch. Puristisch. Propper. Die Konsequenz:
Vieles geht oder ist nicht.
Wer länger bleibt als ein paar Stunden, der muss sich vor allem eins: um- und eingewöhnen. Die mondäne Seebad-Tradition ist Gischt von gestern. Vorbei die Zeit, als sich hier Dichter und Denker, Künstler und A-Promis mit den Vons der Adelsszene trafen. Eine lauschige Sonnenuntergang-Location für Cocktail oder Dinner sucht man vergeblich. Halli-Galli in der Nacht ist gänzlich unbekannt. Das Beobachten frühnächtlicher Flaneure beschränkt sich zumeist auf Hundebesitzer, die zwischen der leeren Promenade und verwaisten Gassen Gassi gehen (müssen).
Beim Abendbummel in kleinen Geschäften stöbern? Geht nicht. Sie sind alle zu. Mit insularer Beharrlichkeit orientieren sich die Öffnungszeiten an längst vergangenen Gesetzen oder an Tagestouristen. Lecker essen, spontan und irgendwann? Nahezu unmöglich. Denn die meisten Restaurants öffnen nur über Mittag und am Abend. Zu festen Zeiten, wie es sich gehört(e). Mit richtig viel Pech sind dann auch bereits alle Tische seit Tagen ausgebucht. Das war übrigens auch schon vor Corona so.
Genüsslich-modernes Urlaubsflair will sich da nicht so richtig einstellen. Gefällige Kurort- oder Strandbad-Idylle auch nicht. Tja, und wenn die echten Helgoländer nicht gerade am, für und um Touristen herum arbeiten, scheinen sie sich am liebsten in ihren Häusern, in ihren Kleingärten (ja, es gibt sogar einen Kleingartenverein!) oder auf ihren Mini-Grundstücken zu verstecken. War aber stadtplanerisch auch so gewollt. Man hat in den 50ern diese Trennung von privat und geschäftlich, von Gästen und Einheimischen als ausgesprochen fortschrittlich empfunden. Und das alles soll man mögen?
Der dritte Blick kommt ab dem dritten Tag.
Ja, es ist der dritte Blick auf die Insel, der doch noch beglücken kann. Er braucht jedoch Interesse an Vergangenem – historisch und geologisch. Und einen wohldurchdachten Plan, um der vorübergehenden Menschen-Fülle am Tage gekonnt aus dem Weg zu gehen.
Am frühen Morgen und ab mittlerem Nachmittag hat man das Oberland mit seiner Vogelwelt, ein paar Schafen und Schmetterlingen, den Blüten des quietschegelben Klippenkohls (vor blauem Himmel und rotem Fels) fast völlig für sich allein.
Über Tag bietet sich das Nord-Ost-Land oder die Düne an, die weitläufig-kleine Insel nebenan. Dort dösen dann auch gerne mal ein paar Meeresbewohner fischesatt am Strand. Oder man folgt der Empfehlung des bereits zitierten Reiseführers: sich in exponierter Lage hinsetzen und die Neuankömmlinge betrachten. Damals war die Landungsbrücke, die man dereinst als Lästerallee bezeichnete, die beste Wahl. Heute bietet sich dafür die lange Promenade an.
Länger Verweilen ohne Langeweile.
Ständig wechselnde Wetterlagen, dramatische Wolkenformationen und besondere Lichtstimmungen. Stille, so weit wie das Meer. Einsame Sonnenauf- und untergänge (am besten auf Oberland) genießen. Weder Autos noch Fahrräder, ruhige Nächte und jede Menge Sterne. Vielfältiges Geflügel bei der alljährlichen Brut und Aufzucht, ein friedliches Miteinander der Zugvögel-Gäste und Stammbewohner. Das alles wirkt nach.
Wer mit längeren Gesprächen aus zwei Worten, dem „Moin, Moin“ der Einheimischen, auskommt und leicht spröde Distanziertheit lieber mag als schnelle Verbrüderungen und Verschwesterungen, fühlt sich hier schnell wohl. Wer sich am Duft der Wildrosen nicht satt riechen kann, die (jahrmillionigen) geologischen und (dramatischen) historischen Wechselfälle eines kleinen Fleckens Erde spannend findet, an fast leeren Ständen gerne seine Jagd-Saison auf Bernstein, Donnerkeile, Ammoniten und anderen
Versteinerungen aus der Urzeit eröffnen mag oder sich auf die Suche nach rotem Feuerstein macht (den gibt es weltweit nämlich nur auf Helgoland), der wird seine Insel-Liebe entdecken. Doch es ginge vielleicht noch besser…
Eine bewusste Zeitreise. Das wär’s.
Wer Helgoland als architektonisches Relikt der Wiederaufbau-Ära (verzeihend) anerkennt, kommt sogar dem Lebensgefühl von einst und dem damaligen Zeitgeist etwas näher. Denn er ist hier überaus lebendig. Eigentlich müssten hier Pettycoat-Partys stattfinden. Natürlich nur am Nachmittag. Eigentlich sollte man hier Unterkünfte im Nierentisch-Design anbieten. Natürlich mit modernstem Komfort. Die Kuchen-klassiker von einst könnten ein Comeback feiern und der Käseigel ein Coming out. Eigentlich könnte man aus diesem „Fifties“ der Insel ein geniales Markenzeichen machen.
In meiner Fantasie habe ich mir das bereits ausgemalt. So wurde Helgoland für mich mehr als nur ein geschichtsträchtiges Natur-Idyll. Es wurde voll cool. Aus Bobtails machte ich Riesenschnauzer, die klitzekleinen Taschenhunde wurden zu moppeligen
Dackeln und zwei Golden Retriever verwandelten sich in frisch frisierte stolze Königspudel. All die Männer in bunten Shorts sahen mit weiten Bügelfaltenhosen und Halbarm-Nylon-Hemden irgendwie auch viel besser aus. Und die holde Weiblichkeit war im schmucken Sonntagskostümchen und kessem Sonnenhut auch um ein Vielfaches bezaubernder – gleichgültig wie die Kiloproportionen waren.
Ich schätze, dass es die aus der Zeit gefallene Helgoland-Aura war. Sie zog mich ab Tag 4 direkt in die Fifties. Und das, obwohl ich sie nie selbst erlebt habe. Ich spürte, dass es eine Zeit war, die den Bruch mit alten Vorbildern wollte, eine von jeglicher Vergangenheit unbelastete Zukunft anstrebte und eine Moderne propagierte, die von heute aus betrachtet, genauso vergangen ist wie die kaiserlich-wilhelminische Zeit. Damals, als Helgoland deutsch wurde. Allerdings nicht als Tauschobjekt für Sansibar. Das ist nur ein Mythos.
Text und Bilder: Copyright Petra Clamer